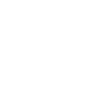Hoffnung haben
Das ist zurzeit nicht die schlechteste Empfehlung. Doch was „kann“ die Hoffnung und was nicht? Ein Rundumblick auf ein wertvolles Gefühl.
Text: Barbara Lang
Gute Noten im Abschlusszeugnis. Die Zusage für eine neue Wohnung. Von einer Krankheit vollständig genesen. Die Erwiderung einer Liebe … Wir kennen Hoffnung in allen Lebenslagen und Schattierungen. Gut so. Denn wer Hoffnung hat, schaut nach vorne, erwartet etwas Gutes. Das macht stark und schützt – wenn die Balance stimmt. Doch dazu später mehr …
Ist Hoffnung haben lernbar?
Hoffnung, Zuversicht, Optimismus – keine deckungsgleichen Synonyme, aber sehr eng miteinander verwandt. Alle drei stehen für eine positive Erwartungshaltung. Etwas, was wir alle in diesen Zeiten gut gebrauchen können und deshalb auch bewusst mehr kultivieren sollten.
Denn Zuversicht ist lernbar. "Es gibt eine genetische Komponente. Zuversicht ist als Disposition angelegt", erklärt Hendrik Berth, Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Medizinische Psychologie im Bereich für Psychosoziale Medizin der TU Dresden im Fachmagazin "Psychologie heute".
Aber in Stein gemeißelt ist diese nicht: „Das Persönlichkeitsmerkmal ist zwar stabil, aber veränderbar, vor allem durch neue Erfahrungen“, konstatiert Berth. Ermutigen Sie sich selbst und Ihre Umgebung also ruhig zu mehr Hoffnung und Optimismus – Sie werden profitieren.
„Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Arzneimittel: Hoffnung und Gelassenheit.“
Pythagoras
Optimismus ist gesund – verschiedene gut belegte Studien bringen das in etwa so auf den Punkt. Denn wer hoffnungsvoll und zuversichtlich ist, schüttet weniger Stresshormone aus, hat einen niedrigeren Blutdruck und damit ein geringeres Schlaganfallrisiko.
Auch die Gefahr, an einer Depression zu erkranken, ist kleiner. Es gibt bereits Ansätze, Hoffnung als Teil von Therapien gezielt einzubinden.

Hoffnung als Sympathiefaktor
Abgesehen von dem erheblichen gesundheitlichen Faktor, mal ehrlich: Mit welchem Menschentyp würden Sie heute lieber zum Kaffeetrinken gehen – mit einem pessimistischen Griesgram oder mit einem hoffnungsfrohen Optimisten?
Sie ahnen es: Hoffnungsträger sind beliebter, wirken attraktiver, sind oft leistungsfähiger und lösungsorientierter. Das Geheimnis dahinter ist nicht schwer aufzudecken: Wer an sich oder eine Sache glaubt – auch wenn nicht alles dafür spricht –, geht aktiver, mutiger und zielgerichteter damit um. Hoffnung und eine positive Erwartungshaltung motivieren uns zum Handeln, während Bedenken, Ängste und Hilflosigkeit uns ausbremsen und lähmen.
Damit hat das Hoffnunghaben eine ganz wichtige Funktion in unserem Leben: Es sorgt dafür, dass wir schwierige Situationen meistern können, indem wir uns anstrengen, dranbleiben und nicht aufgeben.
Das gilt für die kleinen und die großen Herausforderungen des Lebens: Endlich den Satz des Pythagoras verstehen – hoffentlich den Krebs besiegen. Jeder von uns kennt so eine Geschichte von Menschen, die auch nach derben Rückschlägen die Hoffnung nicht verloren haben.
Eine Erfolgsgarantie kann die Hoffnung alleine nicht geben, aber sie kann uns vor Angst und Verzweiflung beschützen, die uns von Anfang an zum Verlieren verdammen würden.
Video
Warum uns Kinder in Sachen Zuversicht einiges voraushaben und wie wir die Zuversicht fördern können, erklärt uns Neurobiologe Prof. Gerald Hüther in diesem Video:
Hoffnung haben, wohldosiert
Doch wie so häufig gibt es sogar bei der Hoffnung auch eine Kehrseite der Medaille: Unseriöse Erfolgstrainer und wenig fundierte Motivationstipps wollen uns manchmal glauben machen, dass es lediglich auf das positive Denken ankommt.
Das Motto „Glaube an dich und alles wird gelingen“ kann auch dazu führen, dass wir gar nicht richtig ins Handeln kommen, dass wir Grenzen und Gefahren ignorieren oder in blindem Optimismus an längst gescheiterten Projekten festhalten – und uns am Ende noch schuldig fühlen, wenn wir scheitern.
Auch wenn wir vor lauter auferlegter Zuversicht gar keine negativen Gefühle mehr zulassen und uns Angst, Trauer oder Wut verbieten, kann uns das schaden. „Toxic Positivity“ nennt die Psychologie so eine Haltung. Auch bei der Hoffnung gilt also die alte Weisheit: Die Dosis macht das Gift.
Hoffnungstraining durch schöne Erlebnisse
Das Ideal liegt also in einer Art real-optimistischer Grundhaltung. Wer das berühmte Glas eher halb voll als halb leer betrachtet, wer auch Mitmenschen ermutigt, sich öfter mal Obamas „Yes, we can“ zu Eigen zu machen, der empowert sich und andere.
Aber was, wenn uns dieses Talent zur Hoffnung nicht so sehr in die Wiege gelegt wurde? Dann heißt es: sammeln! So viele positive Erlebnisse und Emotionen wie möglich. Denn allein dadurch kurbeln wir schon unseren Glückshormonenhaushalt an. Diese stellen sich ein, wenn wir aktiv sind, etwas leidenschaftlich tun, genießen, uns engagieren und eine Sinnhaftigkeit in all dem erleben.
Darüber hinaus können wir trainieren, wie wir die Dinge positiver bewerten: Negatives muss nicht schöngeredet werden, aber mit einer starken Frustrationstoleranz erkennt man eher auch mal das Gute im Schlechten. Und wer tendenziell eher ans Scheitern glaubt als aufs Gelingen hofft, der pimpt seine Erwartungshaltung mit der Frage auf: Was könnte schlimmstenfalls passieren? Wetten, die Antwort relativiert vieles?!
Zur Autorin: Barbara Lang trainiert schon viele Jahre erfolgreich ihren Optimismus: Das Gute im Schlechten erkennen und nicht so oft vorschnell eine Situation oder einen Menschen negativ bewerten – das waren früher ihre Runterziehthemen.
Stand: April 2022
Das könnte Sie auch interessieren:
Artikel teilen auf